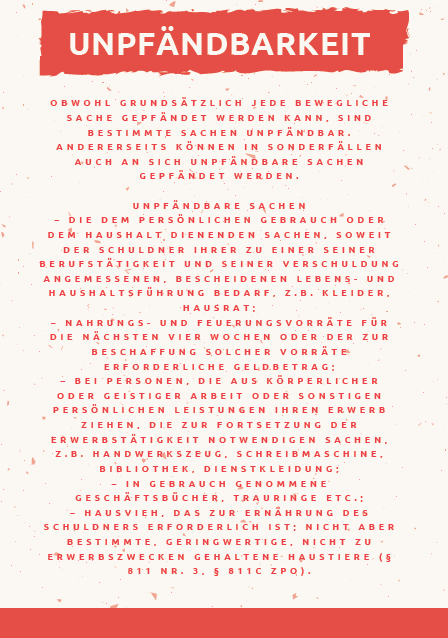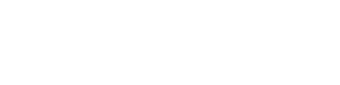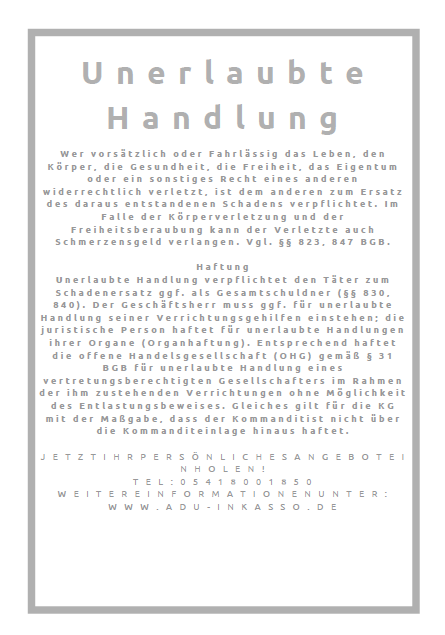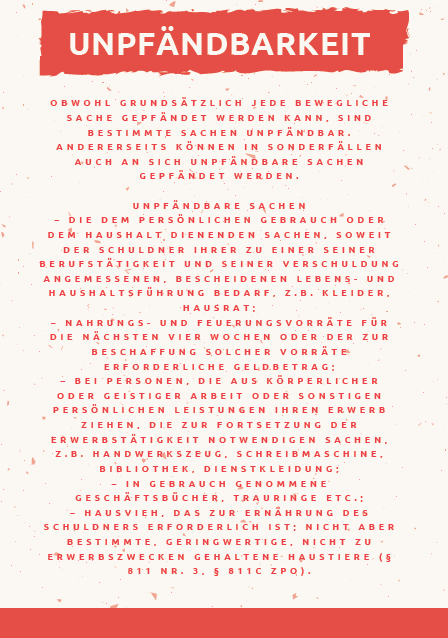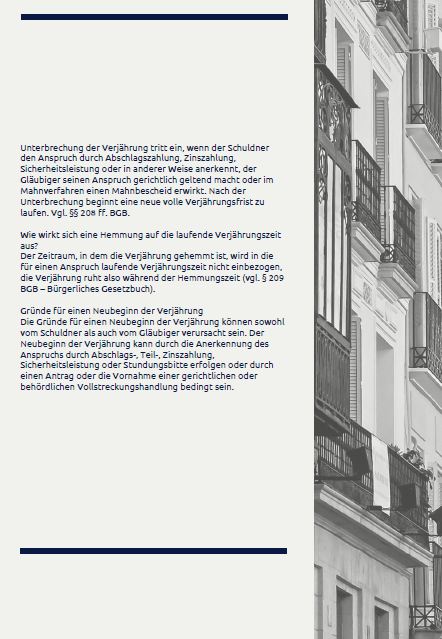Obwohl grundsätzlich jede bewegliche Sache gepfändet werden kann, sind bestimmte Sachen unpfändbar. Andererseits können in Sonderfällen auch an sich unpfändbare Sachen gepfändet werden.
Unpfändbare Sachen
– Die dem persönlichen Gebrauch oder dem Haushalt dienenden Sachen, soweit der Schuldner ihrer zu einer seiner Berufstätigkeit und seiner Verschuldung angemessenen, bescheidenen Lebens- und Haushaltsführung bedarf, z.B. Kleider, Hausrat;
– Nahrungs- und Feuerungsvorräte für die nächsten vier Wochen oder der zur Beschaffung solcher Vorräte erforderliche Geldbetrag;
– Bei Personen, die aus körperlicher oder geistiger Arbeit oder sonstigen persönlichen Leistungen ihren Erwerb ziehen, die zur Fortsetzung der Erwerbstätigkeit notwendigen Sachen, z.B. Handwerkszeug, Schreibmaschine, Bibliothek, Dienstkleidung;
– In Gebrauch genommene Geschäftsbücher, Trauringe etc.;
– Hausvieh, das zur Ernährung des Schuldners erforderlich ist; nicht aber bestimmte, geringwertige, nicht zu Erwerbszwecken gehaltene Haustiere (§ 811 Nr. 3, § 811c ZPO).
Gesetzliche Pfandrechte
Die Unpfändbarkeit trifft auch die gesetzlichen Pfandrechte wie das Vermieterpfandrecht (§ 562 Abs. 1 Satz 2 BGB), Verpächterpfandrecht (§ 592 BGB) oder das Gastwirtpfandrecht (§ 704 Satz 2 BGB). Vermieter, Verpächter oder Gastwirte dürfen für ihre fälligen und unbezahlt gebliebenen Forderungen ihr Pfandrecht nur an pfändbaren Sachen des Mieters/Pächters/Gastes ausüben. Ausnahme bildet der für diese Rechtssubjekte pfändbare gewöhnliche Hausrat. Beim Verpächterpfandrecht, Unternehmerpfandrecht (§ 647 BGB) und den kaufmännischen gesetzlichen Pfandrechten (Kommissionär, Frachtführer, Spediteur und Lagerhalter) ist dagegen eine Unpfändbarkeit nicht vorgesehen.
Unpfändbarkeit einer Forderung
Nach den §§ 850 ff ZPO unterliegen Arbeitseinkommen und andere laufende Bezüge einem besonderen Pfändungsschutz. Grundsätzlich unpfändbar sind Arbeitseinkommen, die nicht mehr als 930,– Euro monatlich (217,50 Euro wöchentlich bzw. 43,50 Euro täglich) betragen, vgl. Tabelle zu § 850 c ZPO (Stand: 1. Juli 2005). Diese Beträge erhöhen sich je nach der Zahl der unterhaltsberechtigten Personen, denen der Schuldner tatsächlich Unterhalt gewährt. So ist z. B. bei einer vierköpfigen „Standardfamilie“ – Alleinverdiener, Ehegatte, zwei Kinder – ein monatliches Nettoeinkommen von bis zu 1.679,99 Euro unpfändbar. Eine Ausnahme besteht jedoch bei der Pfändung wegen Unterhaltsansprüchen: Hier können nach § 850 d ZPO weitergehende Ansprüche pfändbar sein. In der Regel wird hier durch das zuständige Amtsgericht eine niedrigere Pfändungsfreigrenze festgelegt, die sich am Sozialhilfesatz orientiert und im Einzelfall für eine alleinstehende Person auch unter 700,00 Euro im Monat liegen kann.
Lebensversicherungen können vor Pfändung geschützt werden, wenn sie rechtzeitig auf Rentenzahlung umgestellt wurden; die Voraussetzungen sind (siehe § 851 ZPO):
– Leistung nur als Rente auszahlbar (außer im Todesfall) und nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahrs oder bei Eintritt der Berufsunfähigkeit
– Verfügungsverzicht mit dem Versicherungsunternehmen vereinbaren
– als Bezugsberechtigte die Hinterbliebenen benennen.